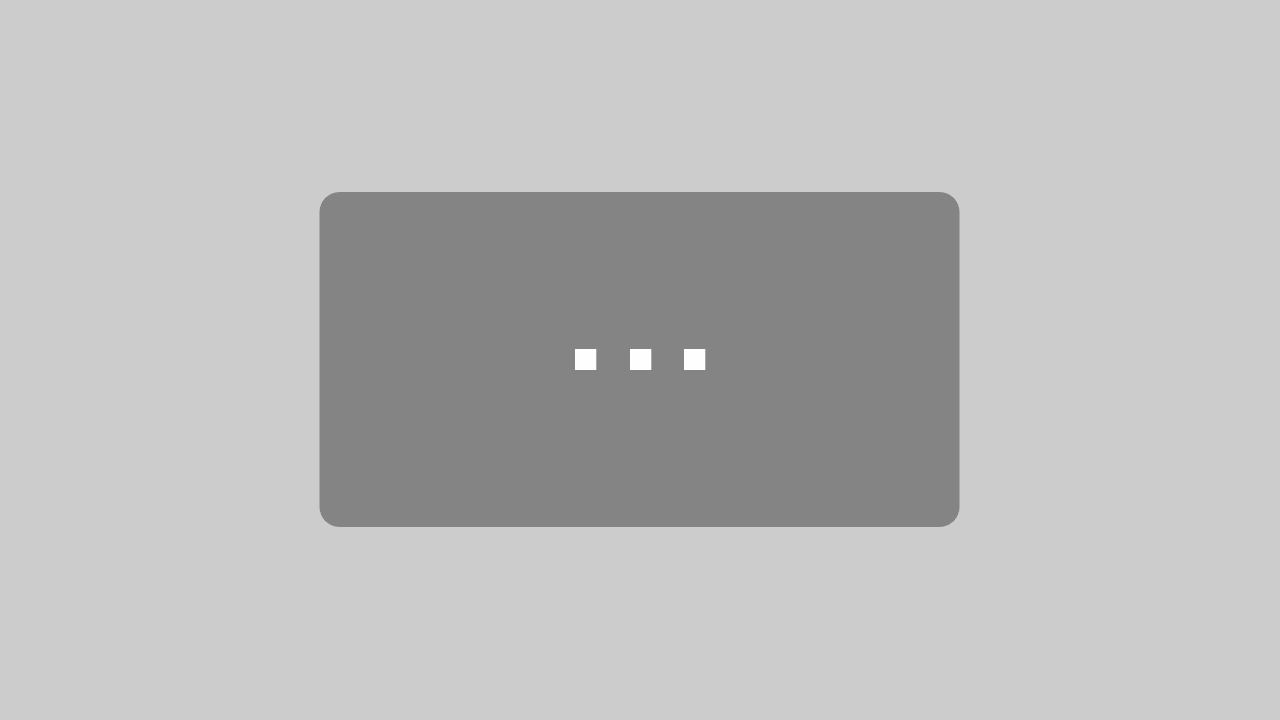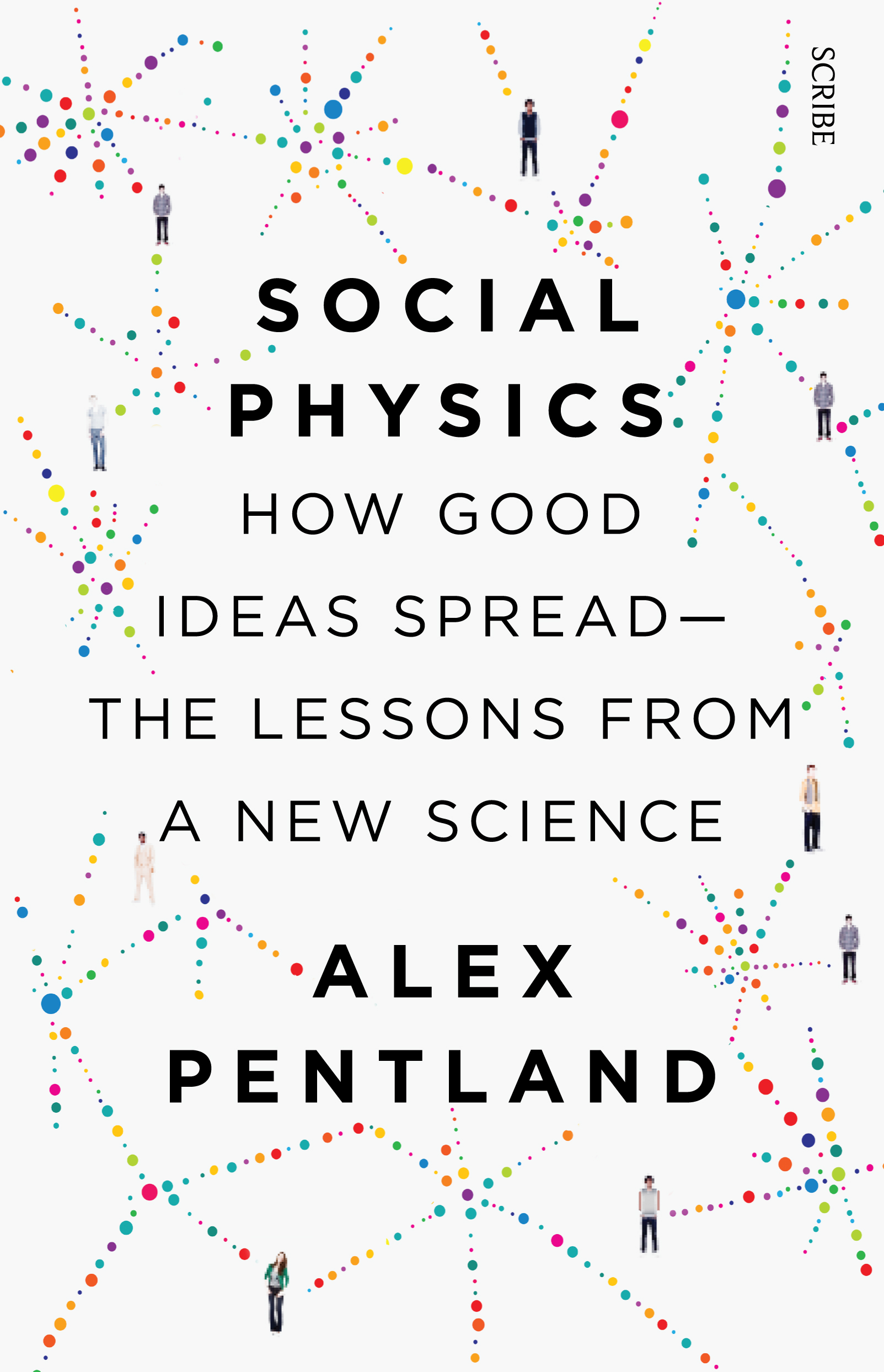Wie Teams am besten funktionieren
Viele Firmen sind falsch organisiert. MIT-Professor Alexander Pentland zeigt, wie Unternehmen innovativ werden.

Mehr Frauen, mehr Gespräche am Kaffeeautomaten, gleiche Beteiligung an Entscheidungen, mehr Rotation durch die Abteilungen: Alex Pentland zeigt, wie Teams bessere Ergebnisse liefern. Und wie falsch viele große Unternehmen organisiert sind – und was sie mit einfachen Mitteln ändern können, um dynamisch zu bleiben.
Alex Pentland betrachtet die Menschen wie mit einem Mikroskop. Über Monate zeichnet er ihre Aufenthaltsorte, Telefonanrufe, E-Mails oder Kreditkartentransaktionen auf. Aus den vielen Millionen anonymisierten Daten über das tägliche Leben kann der Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) berechnen, wie sich Ideen verbreiten. „Ich habe dabei gelernt, dass viele traditionelle Ideen, wie die Gesellschaft funktioniert, falsch sind“, erzählt Pentland, der zu den Pionieren der auf Daten basierenden Sozialwissenschaft gehört. Nicht die Schlauesten haben die besten Ideen, sondern diejenigen, die Einfälle anderer Menschen am besten „ernten“ können. Nicht die Entschlossensten treiben Änderungen voran, sondern diejenigen, die am besten im Team mit Gleichgesinnten arbeiten, sagte Pentland auf der Burda-Innovationskonferenz DLD in New York.
E-Mails können Gespräche nicht ersetzen
Denn damit sich Ideen verbreiten, reicht es nicht, kluge Menschen einzustellen. „Die Mitarbeiter müssen miteinander sprechen. Persönlich, von Angesicht zu Angesicht“, erklärt Pentland. Telefonate oder E-Mails können den persönlichen Austausch nicht ersetzen, was den Verzicht auf Heimarbeitsplätze begründet. Außerdem müssen die Mitarbeiter viele, möglichst verschiedene Ideen von außen ins Unternehmen hereinholen. „Engagement“ und „Exploration“ nennt er die beiden Voraussetzungen für Erfolg.
Damit die Ideen durch die Firmen fließen, sollten die Teams möglichst homogen besetzt sein. Sie funktionieren wesentlich besser als Gruppen mit Stars, wenn diese die Kommunikation dominieren und andere Mitglieder an den Rand drängen. „Es kommt also nicht auf die Persönlichkeit der einzelnen Menschen kann. Viel wichtiger ist, dass alle Mitarbeiter an den Entscheidungen beteiligt werden“, erklärt Pentland. Zudem müssten die Unternehmen schneller reagieren. „Unsere Daten zeigen, dass sich die Welt viel schneller verändert als die Beziehungen in einem Unternehmen. Daher muss die Firma in der Lage sein, ihre Strategie rasch zu ändern – und auch das ist eine Gruppenentscheidung, die nicht an der Spitze getroffen werden sollte“, rät der Professor.
Fähigkeit zur Innovation skaliert nicht
Nun lassen sich homogene Teams in kleinen Start-ups noch relativ leicht bilden. Wenn diese jungen Firmen aber größer werden, muss auch das Organisationsprinzip mitwachsen, was nicht mehr so einfach ist. „Die Fähigkeit zur Innovation skaliert nicht besonders gut. Daher beobachten wir, dass große Tech-Firmen viele innovative Start-ups aufkaufen, um deren Ideen von außen zu holen. Das ist ein großes Dilemma vieler großer Unternehmen. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten. Denken wir an die US-Regierung. Das ist eine enorm große Bürokratie und sehr sehr resistent gegenüber Innovation. Aber es gibt die 50 Bundesstaaten, die mehr Freiheit für Innovationen haben und diese auch nutzen. Einige erfinden etwas und andere kopieren das. So können sich auch Unternehmen aufteilen. Allzu viele haben das nicht getan. Aber denken wir an Google X, das Forschungslabor, das aus dem Konzern herausgenommen wurde“.
Eine Möglichkeit sei die Aufteilung der Belegschaft in viele gleiche Gruppen, die sich intensiv austauschen. In einem Call-Center wuchs die Produktivität auf Pentlands Rat hin schon allein deshalb, indem die Mitarbeiter eines Teams zur gleichen Zeit Pause machten, in der sie sich unterhalten konnten. In einem anderen Unternehmen wurden die Tische in der Kantine verlängert, um den Austausch beim Mittagessen zu erhöhen. Google sei ein gutes Beispiel für eine Innovationskultur. „Mit gemeinsamen Kantinen und Erholungszonen haben sie den Kontakt zwischen den Mitarbeiter halten können, als sie schon einige Tausend Mitarbeiter hatten“. Aber irgendwann werde auch das System nicht mehr funktionieren, wenn die Mitarbeiter über die ganze Welt verteilt sind und die Zentrale so groß ist, dass sich die Menschen nicht mehr begegnen.
Frauen lesen soziale Signale besser
Google habe daher begonnen, die Mitarbeiter rotieren zu lassen. „Sie wurden in verschiedenen Abteilungen eingesetzt, so dass jeder Mitarbeiter einen Kollegen aus jeder anderen Gruppe kannte“. Und wenn das Unternehmen noch viel größer wird, mehrere Zehntausend oder sogar Hunderttausend Beschäftigte hat? „ Dann wird es schwierig. Ich kenne kein Unternehmen dieser Größe, das noch dynamisch ist“, weiß Pentland. Dann helfe nur noch die Aufspaltung in kleinere Einheiten.
Für die Zusammensetzung der Teams seien Frauen besonders wichtig. „Im Durchschnitt können Frauen soziale Signale besser lesen als Männer“, hat Pentland aus seinen Daten erkannt. Frauen pflegten oft einen anderen Stil als Männer. „Sie integrieren Teammitglieder besser und sorgen dafür, dass alle zum Erfolg beitragen. Das sind Hinweise auf soziale Intelligenz. Aber Menschen können soziale Intelligenz auch lernen – Männer und Frauen“, hofft Pentland.
„Tuning“ sozialer Netzwerke
Dass die Teammitglieder miteinander sprechen sollen, bedeutet gerade nicht, dass es viele Meetings geben muss. Entscheidend für die Produktivität sind die informellen Möglichkeiten, andere Teammitglieder zu treffen und sich zu unterhalten. Und die Teammitglieder müssen mit Menschen außerhalb ihrer Gruppe reden können.
Seine Forschungsergebnisse lassen sich auch für das „Tuning“ sozialer Netzwerke nutzen. „In sozialen Netzwerken kommt der Aspekt der Echokammer hinzu. Das ist gefährlich: Man hört eine Meinung immer wieder und denkt, sie seien unabhängig voneinander. Aber oft stammt diese Meinung aus der selben Quelle – und dann ist die Gefahr einer Blase groß“, hat Pentland erkannt. Dafür hat er das Investitionsverhalten der Anlegerplattform eToro über Monate untersucht. Dort können Anleger offenlegen, welche Investitionsentscheidungen sie getroffen haben und welche Rendite sie dabei erzielt haben. Andere Anleger können diesen Nutzern „folgen“, also die gleiche Strategie wählen.
Raus aus der Echokammer
Das Ergebnis: Anleger, die isoliert vom Rest ihre Entscheidungen trafen, erzielten ebenso niedrige Renditen wie die extrem gut vernetzten Anleger, die sich aber – ohne es zu wissen – in einer Echokammer befanden, in der alle Beteiligten die gleichen Informationen hatten. Um 30 Prozent höhere Renditen erreichten die Menschen in der Mitte zwischen den beiden Extremen, also zwischen Isolation und Echokammer. Ob man sich in einer Echokammer befinde, könne man leicht herausfinden. „Man kann leicht feststellen, ob man sich in einer Echokammer befindet. Wenn mehrere Menschen in mehreren Punkten gleicher Meinung sind, ist die Gefahr einer Echokammer groß. Dann haben diese Menschen den gleichen Hintergrund und die vielleicht sogar dieselben Informationsquellen. Viel besser sind Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, die andere Meinungen vertreten“, erklärt Pentland.